|
|
|
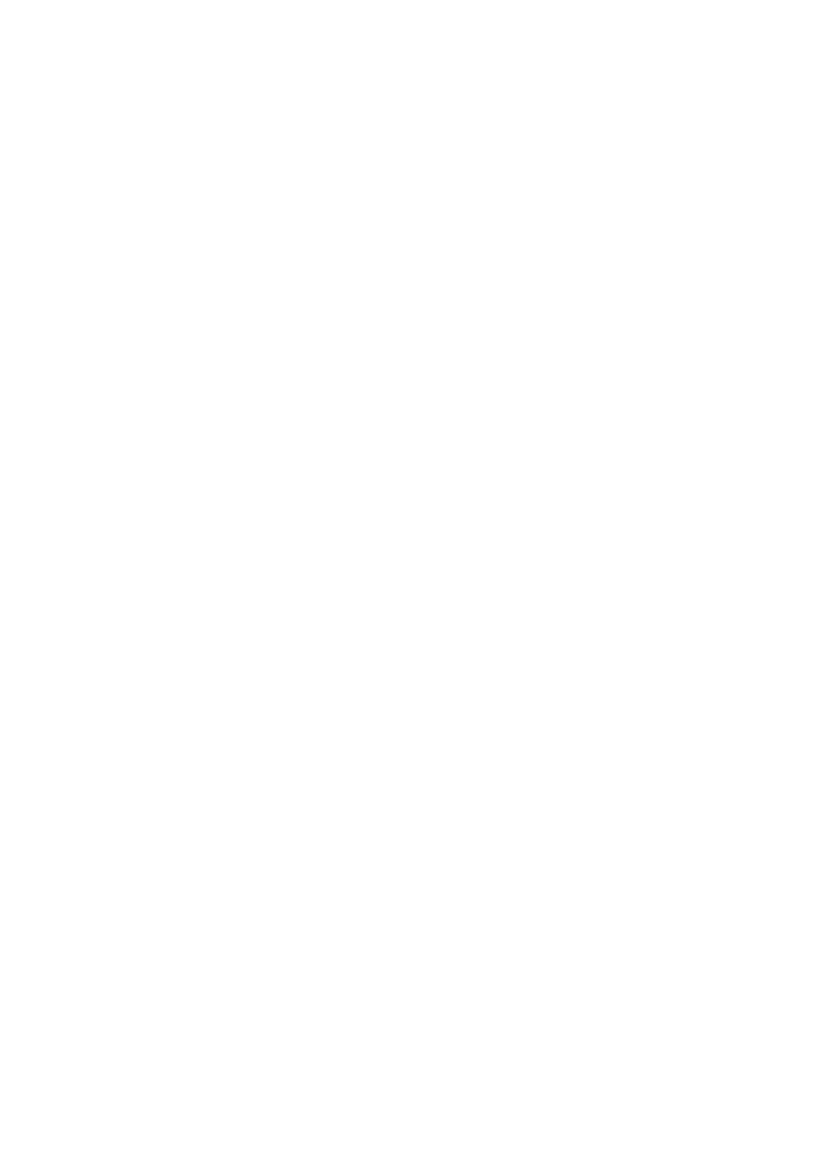 wenig später auch Taschenuhren mit Wecker an. Im Jahre 1686 begann die Geschichte der Viertelschlag-
Repetitions Taschenuhren. Die Eigenart dieser Uhren besteht darin, daß man zu jeder beliebigen Zeit
durch Betätigen eines oder zweier Knöpfe die Zeit schlagen lassen konnte. Zwei Hämmer schlugen, vom
Werk ausgelöst, auf zwei verschiedene Glocken - für den Stundenanschlag auf die große Glocke (tiefer
Ton), für die Viertelstunde auf eine kleinere Glocke (hoher Ton). Später, um 1800, wurden diese Glocken
durch Tonfedern ersetzt. Der Engländer Edward Barlow (1636-1716) konstruierte das Repetitions-
Schlagwerk und wendete es seit 1676 in Pendeluhren, den Bracket-Clocks, an. Daniel Quare (1632-1724)
verbesserte später dieses System.
Einen weiteren, wichtigen Abschnitt in der Entwicklung der Uhrmacherkunst leitete die Erfindung der
»freien« Ankerhemmung für Federzuguhren um 1750 ein. Der englische Uhrmacher Thomas Mudge
(1715-1794) war der Erfinder. Man kann die Funktion des neuen Ankerganges etwa so beschreiben: Ein
schwingender Hebel, ursprünglich in Form eines Schiffsankers, überträgt die vom Rädenwerk kommenden
Antriebsimpulse auf eine unter Einfluß der Spiralfeder frei schwingende Unruh.
Die Erfindung der Schnecke ermöglichte einen gleichmäßigeren Gang zu Beginn und gegen Ende des
Triebfeder-Ablaufes, wobei eine zunächst verwendete Darmsaite bald durch eine Stahlkette als
Kraftübertragungsmittel ersetzt wurde. Eine weit größere Ganggenauigkeit wurde jedoch erzielt, als
gegen das Jahr 1668 von dem Engländer Hooke, bekannt durch das Hooke'sche Federgesetz, und ganz
unabhängig von diesem durch Christian Huygens die Spiralfeder in Uhren angewendet wurde. Um 1675
finden wir dann die ersten Kleinuhren mit Unruh und Spiralfeder.
Bei den Taschenuhren bekam das Gehäuse als Übergang zu den ovalen »lebendigen Eyerlein« zuerst
eine achteckige Form. Bald fand man an den seltsamsten Formen Gefallen: Kreuze, Tulpen, Sterne oder
Totenköpfe. Sie wurden immer reicher verziert, jedes neue Stück war eine künstlerische Schöpfung. Auch
das Uhrwerk selbst wurde, wo sich nur eine Fläche bot, verziert, ausgeschnitten, graviert und sogar mit
Email eingelegt. Die Uhrmacher des 17. und 18. Jahrhunderts waren sowohl Handwerker und Techniker
als auch Künstler. Die Anbringung des Minutenzeigers gegen Ende des 17.Jahrhunderts stellte die Uhren
auf eine höhere Stufe der Genauigkeit. Diese Genauigkeit konnte durch die Einführung des Pendels noch
verbessert werden. Doch obwohl der Vorteil des Pendels gegenüber Waag bzw. Radunruh in Großuhren
augenscheinlich war, dauerte es lange Zeit, bis sich das Pendel durchsetzte. Noch im 18. Jahrhundert
wurden Schwarzwälder Uhren und Comtoiser Standuhren mit Waagbalken gebaut.
Um die Wende von l8. zum 19. Jahrhundert begegnen wir Taschenuhren mit Sekundenzeiger. Kein
geringerer als Abraham Louis Breguet (1747-1823) brachte sie zum ersten Mal auf Taschenuhren an.
Dieser geniale Uhrmacher erfand neben anderen, bedeutenden technischen Verbesserungen für
Taschenuhren auch die noch heute übliche Stoßsicherung in Taschenuhren und das Tourbillon - die
Drehganguhr.
Die Zeit Ludwigs XV. schuf in Frankreich großartig ausgestattete Taschenuhren mit wundervollen
Dekors in farbenprächtigem Email, mit künstlerischen Gravur- und Ziselierarbeiten an den Werken und
zahlreiche, mit Perlen und Edelsteinen besetzte Gehäuse. Für diese Periode vor der französischen
Revolution sind besonders die steifen, langen Knöpfe an den Uhrgehäusen charakteristisch, die später zur
Empirezeit ganz flach wurden. Jede Zeit bevorzugte ganz bestimmte Bügelknopfformen, die Rückschlüsse
auf Alter und Herkunft einer Taschenuhr zulassen. In ähnlicher Weise änderte sich die Zeigerform: hier
ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Originalzeiger häufig zu einer späteren Zeit ersetzt wurden.
Während des ganzen 18.Jahrhunderts dominierte die französische Hofkunst auch in der Uhrmacherei und
dies machte sich durchaus im Stil der Zeit bemerkbar. Typisch sind die französischen Pendulen in
gegossenen, feuervergoldeten Bronzegehäusen mit dem Stempel C-couronné als besonderes Gütezeichen.
Englische Werke des ausgehenden 18.Jahrhunderts hatten vielfach besonders erlesene Kloben, von denen
manche aus Friedberg bei Augsburg stammten, jedoch war in jener Zeit die Bedeutung der deutschen
Uhrmacherkunst, auch in Augsburg und Nürnberg, bereits sehr zurückgegangen, wenn man einmal von
den einfachen Bauernuhren absieht, die damals noch überall in Deutschland gefertigt wurden. Im
deutschsprachigen Raum hatte Wien eine bedeutende Stellung erlangt. Schöne Wand- und Stutzuhren
entstanden dort, und die österreichischen Holzschnitzer arbeiteten mit großem Erfolg die französischen
Bronzependulen in Holz nach, wobei sie ihren Arbeiten durchaus eigene Gedanken mitgaben. Sowohl in
Deutschland als auch in Frankreich bevorzugte die Uhrmacherkunst bestimmte Typen. In Frankreich
dominierte die Cartelluhr, während sich in Deutschland die Telleruhr durchsetzte. Hieraus entwickelte
sich die besonders in Österreich und im süddeutschen Raum vertretene Rokoko-Standuhr. Hier können
wir ihre Abstammung von der Telleruhr ebenso gut zurückverfolgen, wie in Frankreich die Kaminuhr
(die Pendule) als Kind der Cartelluhr anzusehen ist. Diese Uhren aus der Zeit zwischen dem 18. und dem
19. Jahrhundert werden heute im allgemeinen mehr geschätzt als die sogenannten »Biedermeieruhren«
in ihren schlichten Holzgehäusen. Als Gattung für sich sind die um 1750 entstandenen Sägeuhren
anzusehen. Sie wurden nur während einer relativ kurzen Zeitspanne von etwa 50 Jahren gebaut und
mußten den üblichen Gewichts- bzw. Federzuguhren wieder weichen. Sägeuhren werden durch
Schwerkraft angetrieben, die auf das Eigengewicht der Uhr wirkt. Das Antriebsrad ist hier nicht mit einer
Schnurrolle, sondern mit einem Zahnradtrieb (Ritzel) versehen. Dieses Zahnritzel läuft vertikal an einer
ca. 60 cm langen Zahnstange herab und das Uhrwerk setzt sich somit selbst in Gang. Diese Sägeuhren
gingen 24 Stunden und konnten durch einfaches Heraufschieben wieder aufgezogen werden.
Auch die Trageweise der Taschenuhren wechselte. Zur Zeit des Rokoko wird sie von den Herren am
Chatelaine getragen, während die vornehmen Damen den Busen als Verwahrort bevorzugten. In den
zwanziger Jahren des 19.Jahrhunderts trugen auch die Herren ihre Uhren an einer langen Kette um den
Hals, erst um 1830 kam es in Mode, sie an einer kleinen Kette zu befestigen und in die Mitte der bunten
Weste einzustecken.
17
|
|
|