|
|
|
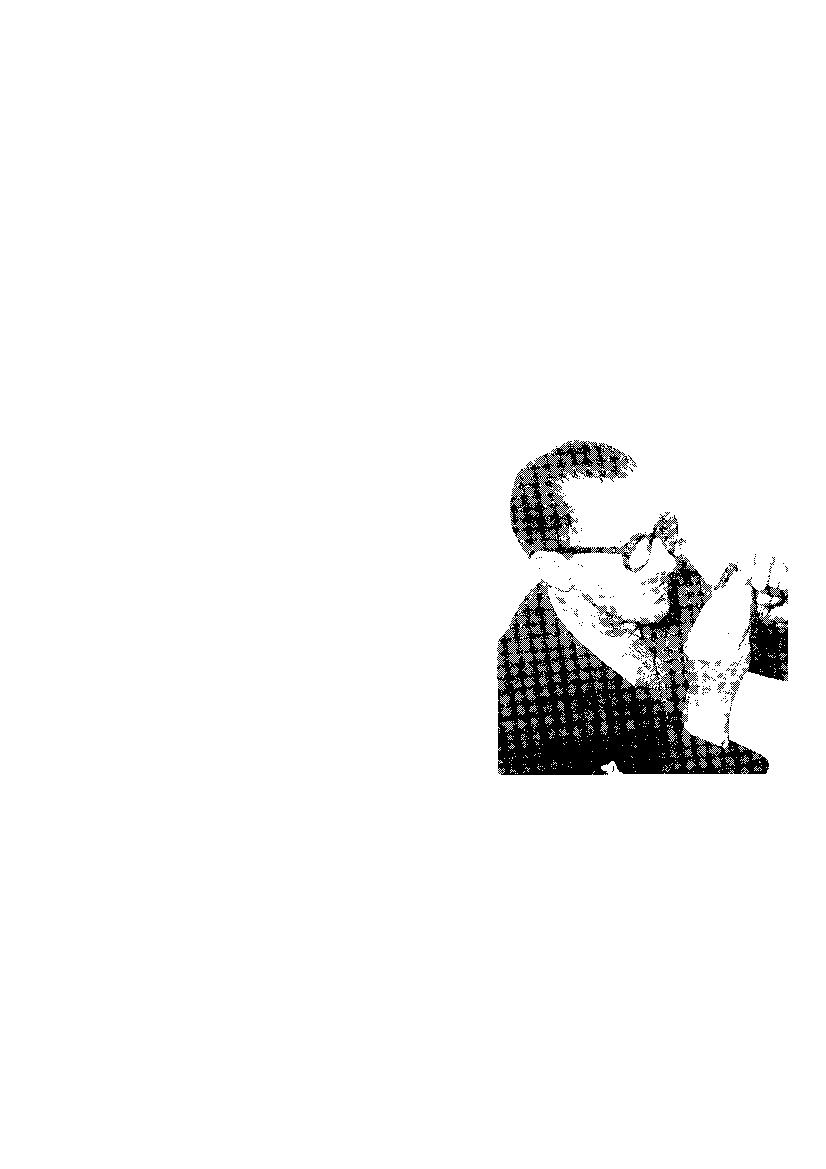 Aus der Geschichte der automatischen Uhr
Die automatische Taschenuhr
Die erste automatische Uhr, es war eine Taschenuhr, wurde im Jahre 1770 von Abraham Perrelet,
dem Älteren, in Le Locle erfunden. Die durch das Marschieren des Trägers entstandenen Stöße brachten
ein Gewicht zum Auf- und Abschwingen das die Uhr aufzog. Die >>Biographie neuchâteloise<<; des
Jahres 1863 schreibt dazu:
«Die ersten Uhren, die er herstellte, wurden von Breguet und von einem in London lebenden Recordon
gekauft. Abgesehen vom Format, waren sie sehr praktisch im Gebrauch. Wenn man sie nicht trug,
erlaubte eine speziell angebrachte Vorrichtung, sie mit einem Schlüssel aufzuziehen.»
In der Schweiz nannte man sie >>Pufferuhr<<, in Frankreich >>Erschütterungsuhr<< und in England
>>Pedometer<< (pedometer type of self winding), was allerdings ein schlechter Ausdruck ist, denn der
Pedometer ist ja ein Schrittzähler, der allerdings auf dem gleichen Prinzip beruht.
Im Jahre 1780 vollendete Breguet in Paris, nach Angaben seines Enkels, die sogenannte
>>immerwährende<< Uhr. Es kann sein, daß er, von' der Idee Perrelets ausgehend, noch andere Systeme
von Perpetualuhren hergestellt hat. Man kennt die Abbildungen von 11 verschiedenen Uhren dieser Art,
die er angefertigt hat. Auch Recordon in London, wahrscheinlich ein gebürtiger Schweizer, ließ ebenfalls
im Jahre 1780 eine Perpetualuhr unter Nummer 1249 patentieren. Dann kamen diese Uhren in die Mode,
und berühmte Uhrmacher, wie Jacquet-Droz und Leschot, stellten sie laufend her. Breguet verwendete
das System des Aufziehens durch Erschütterung auch für
Uhren höchster Qualität. Er brachte es selbst bei der
sogenannten >>Marie-Antoinette-Uhr<< zur Anwendung,
die zu Recht als das große Meisterwerk dieses Uhrmachers
bezeichnet wird.
In England, Amerika und in der Schweiz wurden solche
Perpetualuhren patentiert.Dann trat während eines
Vierteljahrhunderts eine Stille ein.
John Harwood, der Erfinder der automatischen Armbanduhr
Es war während des Ersten Weltkriegs, als der 1894
geborene Sohn eines englischen Uhrmachers, John
Harwood, im schmutzigen Schützengraben lag. Wie gerne
hätte er gewußt, wann er abgelöst werde, aber seine Uhr
war stehengeblieben. Da kam ihm der Gedanke einer
automatischen Armbanduhr. Nach Hause zurückgekehrt,
machte sich John Harwood an die Arbeit und erwirkte im
Jahre 1924 in der Schweiz sein erstes Patent unter
Nummer 106 583. Seine Arbeiten zielten darauf ab, die
Funktionssicherheit der eben aufgekommenen
Armbanduhr zu heben und das Eindringen von Wasser in das Uhrwerk zu verhindern.
Als Synthese einer Reihe von Versuchen entstand schließlich die sogenannte >>Harwood-Uhr<<, bei
welcher weder ein Schlüsselaufzug noch ein, wie heute, seitwärts angebrachter Aufzug vorhanden waren.
Die Zeiger mußten mittels eines drehbaren Glasreifens (Lunette) gerichtet werden, und das Spannen der
Zugfeder wurde durch die manuellen Bewegungen des Trägers über einen sogenannten
Automatenmechanismus besorgt.
Wie die Ebauches-Hauszeitung in einem von Peter Aebi geschriebenen Erinnerungsartikel über John
Harwood zu berichten weiß, war dessen erster Schweizer Reise noch kein Erfolg beschieden. Wie dies oft
bei Neuerungen der Fall ist, zeigte sich die Uhrenindustrie zunächst skeptisch. Eine in der Folge
gegründete Gesellschaft zur Verwertung der Ideen von Harwood war dank der finanziellen Deckung
erfolgreicher.
Es war im Jahre 1926, als John Harwood mit dem Großunternehmen der Ebauches-Industrie, A. Schild
AG, in Verbindung trat. Gleichzeitig wandte er sich durch Intervention des damaligen Fortis-Aktionärs
Ernst Schild an die Fortis AG mit dem Ersuchen, seine automatischen Rohwerke bei diesem
Unternehmen montieren zu lassen und unter dem Namen Harwood in den Handel zu bringen. Der
Gründer der Firma Fortis, Walter Vogt (übrigens ein Bruder von Gottlieb Vogt-Schild sel., des Verlegers
von «The Swiss Watch»), machte sich mit großem Eifer an die Verbreitung dieser neuen und
epochemachenden Erfindung.
21
|
|
|